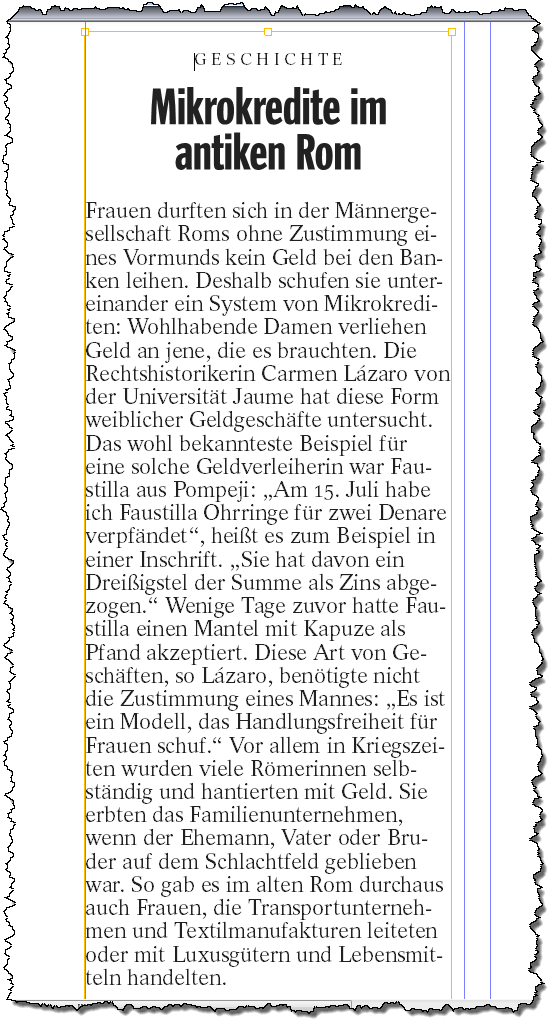Erschienen in Prisma, Spiegel (Printausgabe) 20/2012.
Archiv der Kategorie: Antike
Maulwürfe als Helfer
Whitney Castle, ein römisches Fort in Nordengland, unterliegt dem Denkmalschutzgesetz und das verbietet dort Grabungen. Deshalb freuen sich die Forscher über ein Heer kleiner Hilfskräfte: Maulwürfe. Da die Tiere keine Gesetze lesen können, wühlen sie beharrlich römische Artefakte an die Oberfläche. Im April siebten drei Dutzend Hobbyarchäologen unter den strengen Augen der Aufsichtsbehörde English Heritage die Maulwurfshügel durch und förderten so römisches Tischgeschirr, ein Stück wertvoller Tafelkeramik und die Perle einer Halskette zutage. Schon im vergangenen Jahr hatte ein Maulwurf ein delphinförmiges Bronzestück aus dem Erdreich gebuddelt, wahrscheinlich der Handgriff eines antiken Wasserhahns. Mit ihrer Arbeit helfen die Tiere auch, wichtige wissenschaftliche Fragen zu beantworten: So fanden die Archäologen jede Menge Nägel in der Maulwurfserde. Damit ist wahrscheinlich: Die Römer bauten die Gebäude ihres Außenpostens nicht aus Stein, sondern aus Holz.
Erschienen in Prisma, Spiegel (Printausgabe) 19/2012.
Promi-Werbung für die Armee
Stars aus der Welt des Sports wurden in der Antike offenbar gezielt eingesetzt, um junge Männer für den Dienst in der römischen Armee zu begeistern. Belegt ist dies zumindest für die Stadt Oinoanda im Südwesten der heutigen Türkei. Dort warb vor rund 1800 Jahren der erfolgreiche Ringer und Athlet Lucius Septimius Flavianus Flavillianus Rekruten für die römischen Legionen an, wie eine in der Zeitschrift Anatolian Studies veröffentliche Inschrift verrät. Dem Text zufolge eskortierte Flavillianus die Männer anschließend selbst in die Stadt Hierapolis. Das Charisma des Ausnahmekämpfers tat offenbar seine Wirkung: Die Jugend folgte seinem Werben in Scharen. Von den Siegen des Athleten im Ringen und im Pankration, einer besonders blutigen Kampfsportart, berichten auch andere Inschriften in der Stadt. Dank seiner immensen Berühmtheit fiel es Flavillianus wahrscheinlich leicht, Freiwillige zusammenzutrommeln, erklärt Studienautor Nicholas Milner vom British Institute in Ankara.
Erschienen in Prisma, Spiegel (Printausgabe) 15/2012.
Grabwächterarmee
Erschienen in Geo, April 2012
Sardische Steinsoldaten sind ein halbes Jahrtausend älter als die chinesischen Terrakotta-Krieger
Vor 2500 Jahren wurden die Figuren von Feinden zerschlagen – nun haben Archäologen und Konservatoren eine Truppe von sardischen Steinkriegern aus Tausenden von Fragmenten wieder zusammengesetzt. Die zwei bis zweieinhalb Meter großen Statuen bewachten um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. die Gräber der Herrscher-Elite.
Palast unter Wasser
Erschienen in Spiegel Geschichte 2/2012
Intensiv fahnden Archäologen nach steinernen Zeugnissen, doch Kleopatra ist kaum zu fassen.
Griechen in Not
Auch für Ausgrabungen fehlt in Griechenland derzeit das Geld. Griechische Archäologen sind deshalb dazu übergegangen, neue Funde lieber nicht auszugraben, als sie an der Oberfläche verfallen zu lassen. Mutter Erde ist die beste Beschützerin für unsere Altertümer, erklärte Michalis Tiverios von der Aristoteles-Universität Thessaloniki am Rande eines Kongresses in Athen. Auf sein Betreiben bleiben etwa Reste einer frühchristlichen Kirche in Thessaloniki unangetastet, die vor zwei Jahren entdeckt worden sind. Lasst unsere Altertümer in der Erde, damit Archäologen sie 10000 nach Christus finden können – wenn die Griechen und ihre Politiker mehr Respekt für ihre Geschichte gelernt haben, fordert Tiverios. Ein weiteres Problem sind die Plünderer: Auch für Sicherheitspersonal, das die Altertümer bewacht, ist kaum Geld da. Unlängst machten sich Raubgräber über den antiken Friedhof von Pella her, der einstigen Hauptstadt des Makedonenreiches unter Alexander dem Großen. Auf dem Areal wurden verstorbene Herrscher oft mit reichen Goldbeigaben bestattet. Im Jahr 2011 konnten wir dort nicht arbeiten, beklagt sich Grabungsleiter Pavlos Chrysostomou. Wir fanden aber zehn neue Gruben vor, die nicht wir geschaufelt hatten.
Erschienen in Prisma, Spiegel (Printausgabe) 11/2012.
Fesch und Chips
Erschienen in Geo, März 2012
Zahlte man in Bordellen Englands mit Spielgeld? Eine Münze aus römischer Zeit legt dies nahe
Der kleine Chip sieht aus wie ein Geldstück. Doch was jüngst mit einem Metalldetektor aus dem Uferschlamm der Themse gefischt wurde, konnte man gewiss nicht in einem Gemüseladen gegen Blumenkohl eintauschen. Denn die Vorderseite trägt nicht das Konterfei eines Kaisers oder einer Gottheit – sondern zeigt einen Mann und eine Frau beim Sex: Die Frau liegt auf dem Bauch, der Mann kniet über ihr. Auf der Rückseite steht die römische Zahl XIIII.
Costa Concordia verunglückte über antikem Schiffsfriedhof
Der Kapitän der Costa Concordia war nicht der Erste. In den vergangenen 2600 Jahren versenkten mehr als ein Dutzend Seefahrer ihre Schiffe rund um die Insel Giglio. Fast hätte der Italiener das Kreuzfahrtschiff sogar auf ein antikes Wrack gesetzt.
Bewacher aus Stein
Die Armee ist zwar klein, aber bemerkenswert: Auf Sardinien haben Archäologen und Konservatoren eine Schar lebensgroßer Steinskulpturen aus dem 8. Jahrhundert vor Christus wiederauferstehen lassen. In acht Jahren mühsamer Puzzlearbeit setzten sie die in viele tausend Teile zersprungenen Krieger wieder zusammen. Nun sollen im Sommer 25 der Steinsoldaten im Archäologischen Nationalmuseum von Cagliari im Süden der Insel ausgestellt werden. In der Eisenzeit schmückten sie die Elitegräber der späten sardischen Nuraghen-Kultur, ein halbes Jahrtausend bevor ein chinesischer Kaiser auf eine ähnliche Idee mit Soldaten aus Terrakotta kam. Unter den sardischen Kriegern sind Bogenschützen und wahrscheinlich auch Schwertkämpfer. Einige weitere als „Boxer“ bezeichnete Statuen halten in der linken Hand ihren Schild über den Kopf. Viele tragen Rüstungen und gehörnte Helme. Die Nuraghen-Kultur beherrschte Sardinien vom 18. bis ins 6. Jahrhundert vor Christus. Bis heute sind rund 7000 ihrer Befestigungsanlagen auf der Mittelmeerinsel bekannt. Genützt hat es ihne am Ende nichts: Die Karthager eroberten Sardinien nach und nach – und zerschlugen dabei wohl auch die steinernen Krieger.
Erschienen in Prisma, Spiegel (Printausgabe) 09/2012.
Sex für 14 Asse
Aus dem Schlamm der Londoner Themse hat ein Hobbysucher ein römisches Metallstück gefischt, bei dem es sich nach Ansicht von Historikern um einen Bordellchip handeln könnte. Die Vorderseite des Fundes zeigt eine auf dem Bauch liegende nackte Frau, über der ein Mann kniet. Auf der Rückseite steht eine Zahl: 14 – möglicherweise der Preis für die dargestellte sexuelle Dienstleistung. 14 römische Asse entsprachen im ersten Jahrhundert nach Christus, aus dem der Zufallsfund stammt, etwa dem Tageslohn eines Arbeiters oder dem Preis für mehrere Laibe Brot. Solche Münzen (Spintriae) könnten die gängige Währung in Bordellen mit Sklavinnen gewesen sein, damit diese selbst kein Geld in die Hände bekamen. Außerdem war es zumindest unter Kaiser Tiberius verboten, normale Münzen mit in die Lusthäuser zu nehmen – weil sie sein Bild trugen. Andere Wissenschaftler halten Funde dieser Art für Spielsteine von Brettspielen.
Erschienen in Prisma, Spiegel (Printausgabe) 03/2012.